Braunschweig. Zwei Braunschweiger Linguisten üben Kritik an einer neuen Studie von Psychologen der TU Braunschweig zur Verständlichkeit gegenderter Texte.
Wie verständlich sind Texte mit gegenderter Sprache? Immer wieder fällt das Argument, dass das Verstehen durch Doppelnennungen, Gendersternchen, Unterstriche oder Doppelpunkte komplizierter und schwieriger wird. Die Psychologen um die Professorin Elke Heise und Marcus Friedrich von der TU Braunschweig haben jetzt eine neue Studie zum Thema vorgelegt – zum immer stärker verbreiteten Gendersternchen.
Das Ergebnis: Die Teilnehmer, allesamt Studierende, bewerteten Texte mit den gegenderten Formen als genauso verständlich wie solche mit generischem Maskulinum. Friedrich, mit dem unsere Zeitung sprach, fasste das zentrale Ergebnis der Studie so zusammen: „Wir haben gezeigt, dass sich das oft wiederholte, plausibel klingende Argument, mit Sternchen gegenderte Texte seien unverständlicher, so nicht belegen lässt.“
Unterschiede beim Verständnis von Singular- und Pluralformen
In zwei Experimenten wurden den jeweils weit über hundert Teilnehmern verschiedene Texte vorgelegt. Es handelte sich um verschiedene Versionen von Spielanleitungen: herkömmliche, in denen das generische Maskulinum („der Spieler“, „der Angreifer“) verwendet wird und solche, in denen das Gendersternchen zum Einsatz kommt. Bei letzterem wurde noch zwischen Pluralformen („die Spieler*innen“) und Singularformen (der*die Angreifer*in) unterschieden.
Während die Pluralform sich als ebenso verständlich erwiese wie die ungegenderten Texte, habe sich im Singular „eine deutliche Beeinträchtigung durch das Gendersternchen“ ergeben, so Friedrich. Beispielsätze lauteten hier etwa: „Jede Mannschaft schickt abwechselnd eine*n Angreifer*in – die*den sogenannte*n Raider*in – in die gegnerische Mannschaft.“
Linguist Burkhardt: Ergebnisse waren absehbar

Armin Burkhardt, den emeritierten Professor der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität, wundert dieses Ergebnis nicht. Es sei „so absehbar wie das Amen in der Kirche“, sagt der Linguist, der seit seinem Studium in Braunschweig lebt. Er ist erklärtermaßen kein Fan des Gendersternchens. „Von der Gleichstellung von Frauen, Diversen und anderen halte ich sehr viel, vom Gendern allerdings fast nichts“, schickt der Linguist im Gespräch mit unserer Zeitung voraus.
Auch sonst überraschen ihn die Ergebnisse der Braunschweiger Studie, so wie diese durchgeführt wurde, wenig. Da die Studienteilnehmer allesamt Studierende waren, „die im Umgang mit Gendersprache trainiert sind“, sei zu erwarten gewesen, dass es keine Verständnisprobleme geben würde.
Ähnlich kritisch äußert sich TU-Professor Martin Neef. Wie Burkhardt kritisiert der Braunschweiger Linguist die Auswahl der Teilnehmer. „Zum einen sind Studenten diese Art des Genderns gewohnt“, sagt er, „zum anderen liest man, gerade weil es hässlich und ungrammatikalisch ist, spätestens ab dem dritten Sternchen darüber hinweg“.
Lesen Sie auch: Städte und Landkreise der Region arbeiten an „Gender“-Regeln
Weitere ergänzende Studien sind geplant
Zumindest die Kritik an der Auswahl der Studien-Teilnehmer kann Marcus Friedrich nachvollziehen, fügt sogar einschränkend hinzu: „Die Studierenden, die wir befragt haben, waren überwiegend weiblich, und wir wissen, dass Frauen gegenüber gendersensibler Sprache eher aufgeschlossen sind als Männer.“ Deswegen, erklärt er, wollen die TU-Psychologen ihre Annahmen in einem nächsten Schritt auch anhand anderer Personengruppen überprüfen. Geplant seien weitere Studien mit Schülern, Deutschlernenden, sowie mit Menschen mit niedrigerer Lesekompetenz, die etwa auf Texte in einfacher Sprache angewiesen sind.
Ärger über gegenderte Texte wird künftig miterfasst
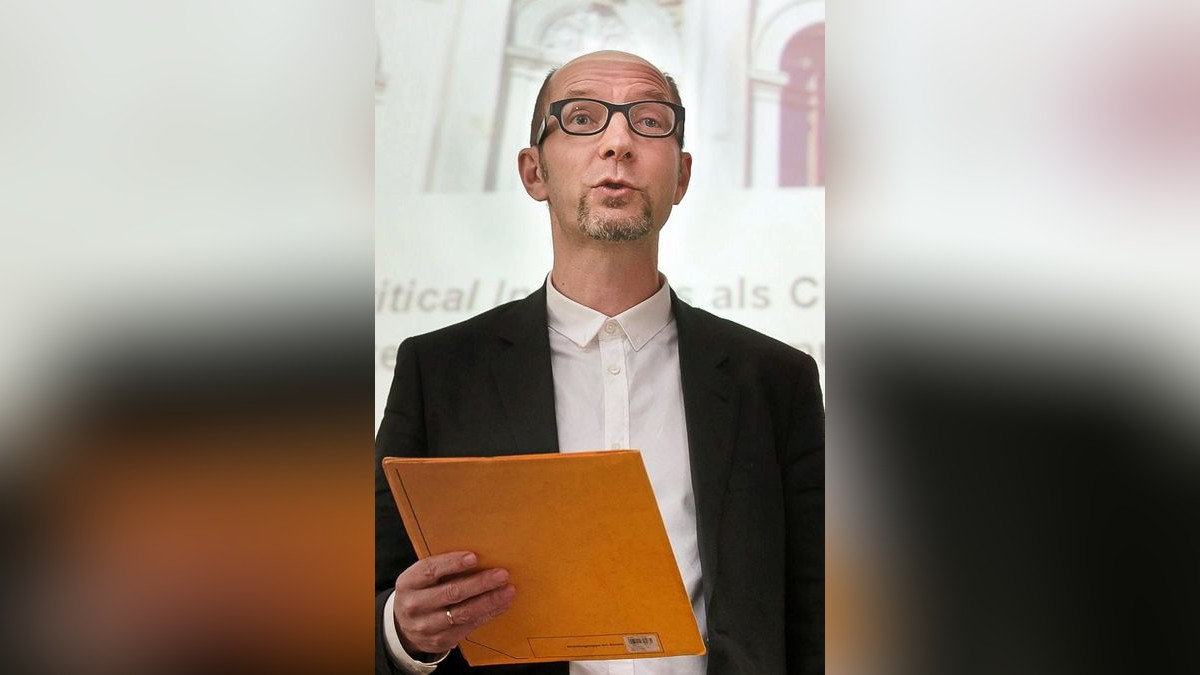
Außerdem, so Friedrich, wollen die Psychologen künftig zusätzlich zum reinen Textverständnis auch die Einstellung der Probanden zum Gendern und ihre Emotionen beim Lesen berücksichtigen. Bei einer Studie, die gerade noch begutachtet werde, habe man dies bereits getan. „Es scheint so, dass diejenigen, die das Gendern ablehnen, sich zwar ärgern, sie diese Texte aber ebenso gut verstehen, wie herkömmliche." Den Ärger, berichtet er, habe man über einen Kommentarbereich erfasst, in dem die Probanden ihrer Unzufriedenheit Luft machen konnten.
Auch wenn Einstellungen und Emotionen künftig miterfasst werden, vermisst Neef an vielen Studien und Debatten zur geschlechtergerechten Sprache etwas Grundlegendes: Die Sicht von Sprachwissenschaftlern werde kaum berücksichtigt. „Es wird gegendert ohne Rücksicht auf Grammatik“, moniert der Linguist – auch mit Blick auf die Versuchstexte der Braunschweiger Psychologen. Dieses Problem werde aber oft überhaupt nicht thematisiert. Auch ihm sei es ein Anliegen, geschlechtergerecht zu formulieren, eben dies erlaube aber das generische Maskulinum. Leider, bedauert er, sei der Begriff geschlechtergerechte Sprache mittlerweile im „allgemeinen Verständnis zu einem erfolgreichen Markennamen für eine ganz bestimmte Sprechweise geworden“.
Auch in der Linguistik gibt es Befürworter des Genderns
Neben kritischen Stimmen gibt es auch in der Linguistik Befürworter des gendergerechten Sprachgebrauchs – Männer wie Frauen. Das generische Maskulinum ist nicht mehr unumstritten, auch Neef gibt dies unumwunden zu und verweist auf hitzige Debatten im Linguistenverband. An seiner Kritik, dass Linguisten zu wenig Gehör finden, ändert das nichts: „Wenn ich ein Problem mit der Sprache als System habe, frage ich doch erstmal jemanden, der sich damit auskennt und nicht Juristen, Soziologen oder, mit Verlaub, Psychologen.“
Lesen Sie auch:Guck mal, wer da tanzt! – Das Gender-Dilemma
Auch für Burkhardt ist das Gendern mit dem Stern keine Lösung. „Natürlich kann man immer alle Gruppen aufzählen“, sagt er, „aber hier wird versucht, auf der Ebene des Oberbegriffs, also zum Beispiel „Spieler“, alle möglichen Unterbegriffe mit einzubauen – eine aberwitzige Vorstellung.“ Was er meint, erklärt er mit einem Beispiel: „Am Begriff „Haus“ müssen doch auch nicht alle möglichen Arten von Gebäuden deutlich werden“, so Burkhardt. „Diejenigen, die mit Gendersternchen und Co. arbeiten, um Gruppen sichtbarer zu machen, tun etwas, wofür unsere notwendigerweise abstrakte Sprache nicht gemacht ist.“
„Herumdoktern an den Symptomen“
Aus Burkhardts Sicht betonen Gendersternchen das durch das generische Maskulinum („Handwerker“) oder Femininum („Fachkraft“) ohnehin Selbstverständliche, nämlich alle zu benennen. „Stattdessen“, sagt er, „sollte man die verschiedenen Geschlechter da betonen, wo sich nicht von selbst versteht, dass nicht nur Männer oder nicht nur Frauen gemeint sind.“ Dies aus Prinzip und immer zu tun, hält er für einen Abweg. „Wir müssen an der Gesellschaft arbeiten, nicht an der Sprache. Das scheint mir relevanter zu sein, als am generischen Maskulinum und damit an Symptomen herumzudoktern.“
Friedrichs sieht das anders. In seiner Lehre bemüht er sich, auf das generische Maskulinum zu verzichten, „damit sich möglichst alle angesprochen fühlen“. Er fände es schön, „wenn die Geschlechter auch in der Sprache gleichberechtigt nebeneinander stehen“, sagt er – privat, versteht sich. „Als Forscher geht es mir darum, wissenschaftlich geprüfte Argumente zu liefern und Aufklärung zu betreiben.“ Nach kurzem Überlegen fügt er aber doch hinzu: „Und Vorbild zu sein“.
Lesen Sie hier den Kommentar unseres Autoren zum Thema.
